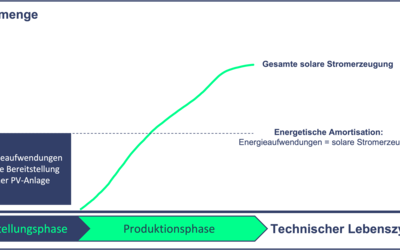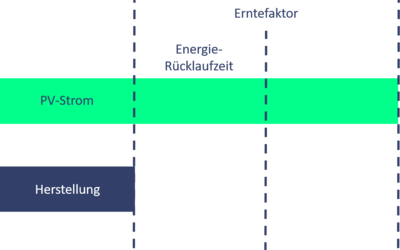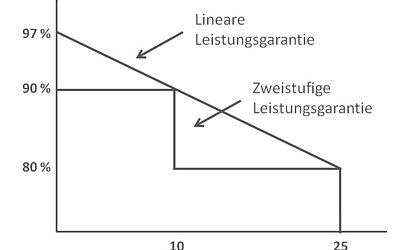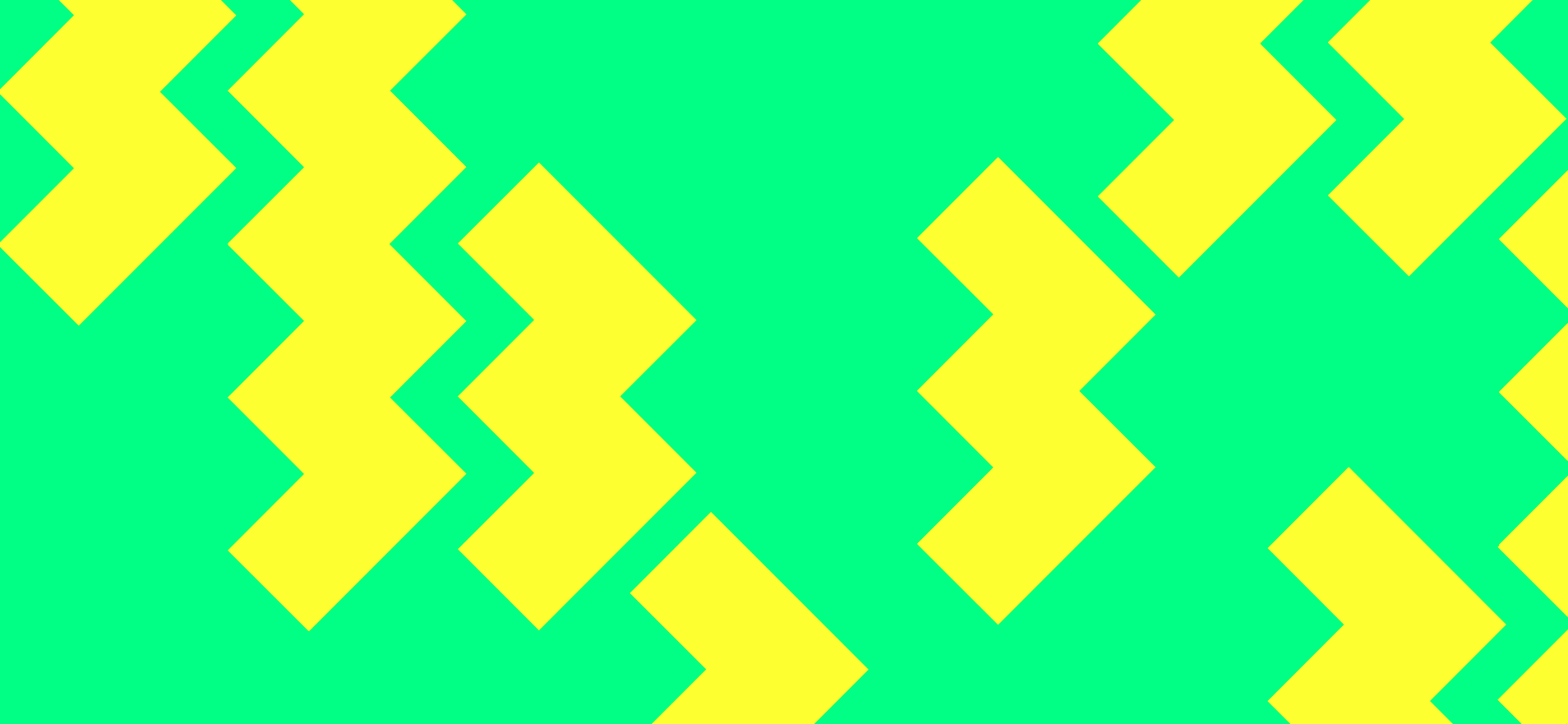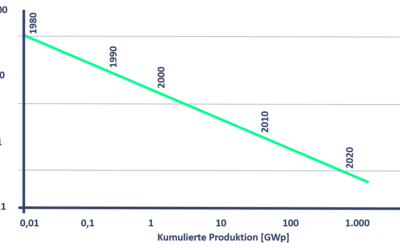PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Photovoltaik Pachtmodell
Eine gepachtete Photovoltaikanlage erlaubt es, Solarstrom auf dem eigenen Dach zu erzeugen, ohne dafür eine größere Investition vornehmen zu müssen. Grundsätzlich spricht nichts gegen dieses Modell, sofern die Konditionen realistisch kalkuliert sind. Dies ist leider nicht immer der Fall.
Wie das Pachtmodell funktioniert
Um alle Verwechslungen auszuschließen: Gemeint sind hier nicht die Modelle, in denen ein Hausbesitzer sein Dach an einen Anlagenbetreiber verpachtet. Dieses vor allem im landwirtschaftlichen Bereich anzutreffende Modell weist auch seine Vorzüge auf, soll aber hier nicht betrachtet werden.
Stattdessen geht es um Modelle, in denen ein Hausbesitzer selbst eine Photovoltaikanlage pachtet. Die Begriffe "pachten" und "mieten" können hier ausnahmsweise synonym verwendet werden, da Rechte und Pflichten in beiden Varianten nahezu identisch geregelt sind.
Vertragspartner sind dabei oft die kommunalen Stadtwerke oder ein anderes Energieunternehmen. Diese kooperieren ihrerseits mit einem spezialisierten Dienstleister. In den meisten Modellen – aber nicht immer - sind mit der monatlichen Pacht sämtliche Kosten abgegolten, also auch die Montage und die spätere Wartung. Der Pächter kann den Solarstrom selbst verbrauchen oder ins Netz einspeisen.
Gemäß EEG ist der Pächter der Besitzer der Anlage
Das EEG behandelt den Pächter genau so, als hätte er die Photovoltaikanlage selbst gekauft. Besitzer der Solaranlage ist der Hausbesitzer, Eigentümer ist das verpachtende Unternehmen.
Das bedeutet übrigens auch, dass nur der Hausbesitzer die Anlage bei der Bundesnetzagentur anmelden kann und damit Anspruch auf die Einspeisevergütung hat – nur der Besitzer kann diese Anmeldung durchführen. Die Meldung beim zuständigen Netzbetreiber kann dagegen vom Verpächter vorgenommen werden.
von Ulrike Moreau aus Sömmerda
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENPachten oder kaufen?
Es gibt keine zwingenden Gründe, eine der beiden Alternativen grundsätzlich zu bevorzugen. Da die Einnahmen in beiden Fällen gleich sind, ist die wirtschaftlich günstigere Variante diejenige, die über die gesamte Lebensdauer der Photovoltaikanlagedie geringeren Kosten verursacht.
Die Kosten des Pachtmodells sind sehr einfach zu berechnen, da die monatlichen Kosten konstant sind. Bei einem Kauf sind die Gesamtkosten schwieriger zu kalkulieren.
Neben dem Kaufpreis (inklusive Montage) sollten etwa 1,5 Prozent des Kaufpreises als jährliche Unterhaltskosten einkalkuliert werden. Hinzu kommen die Finanzierungskosten oder im Fall eines Barkaufs die entgangenen Zinseinnahmen.
Nicht zu viel rechnen
Vergleichsrechnungen zwischen Barkauf und Pachtmodell sollten aber auch nicht mit zu spitzer Feder durchgeführt werden. Die meisten Pachtmodelle beinhalten ein komplettes Servicepaket, bei dem sich der Anlagenbetreiber um nichts zu kümmern braucht.
Eine offensichtliche Schwäche betriebswirtschaftlicher Kalkulationen für Projekte privater Haushalte besteht darin, dass sie eben nicht berücksichtigen, sich niemals selbst mit Versicherungen oder Handwerkern streiten zu müssen.
Mit oder ohne Stromspeicher?
Photovoltaikanlagen können mit oder ohne Stromspeicher gepachtet werden. Ein Speicher steigert den finanziellen Ertrag deutlich, weil der Eigenverbrauch erheblich höher ist und damit der Anteil des Stroms sinkt, der für die vergleichsweise niedrige Einspeisevergütung ins Netz eingespeist wird.
Dies gilt für gekaufte und gepachtete Photovoltaikanlagen gleichermaßen, weswegen das Thema der Rentabilität von Stromspeichern für Pachtmodelle nicht separat diskutiert werden muss.
Es gibt keine belastbaren Rentabilitätsberechnungen
Wirklich belastbare Rentabilitätsberechnungen existieren nicht, da niemand die Preisentwicklung über 20 Jahre vorhersagen kann. Dies ist nicht allzu kritisch, da sich Photovoltaikanlagen unter allen realistischen Annahmen rechnen, strittig ist nur die Höhe der Rendite.
Problematisch ist aber, dass die Berechnungen der einzelnen Anbieter nicht vergleichbar sind, weil die diesbezüglichen Annahmen nicht von allen offengelegt werden. Daher empfiehlt es sich, den Vergleich zwischen den Anbietern anhand der technischen Ertragsprognose und der Gesamtkosten des Pachtvertrags vorzunehmen und die prognostizierten Renditen zu ignorieren.
Was im Pachtvertrag geregelt sein sollte
Wichtig ist zunächst, ob der Pachtvertrag wirklich alle anfallenden Kosten abdeckt, also zum Beispiel auch die Versicherung der Photovoltaikanlage. Darüber hinaus sollten Hausbesitzer auch daran denken, dass das Haus möglicherweise während der Laufzeit des Pachtvertrags verkauft werden soll.
Daneben sollte der Pachtvertrag auch regeln, wer die Zusatzkosten trägt, wenn Reparaturen am Dach erforderlich sind, die zwar nicht mit der Photovoltaikanlage zusammenhängen, aber deren Demontage erfordern. Wichtig ist auch, was mit der Anlage nach Ablauf des Pachtvertrags geschieht.
Relativ unproblematisch ist meist die weitere Nutzung geregelt. Viele Verträge sehen hier eine Kaufoption für einen symbolischen Euro vor. Manchmal fehlen aber Regelungen für den Fall, dass die PV-Anlage nicht weiter genutzt werden soll.
Pachtmodelle sind ein einfacher Weg zum eigenen Solarstrom
Pachtmodelle erlauben es, Solarstrom ohne eigene Anfangsinvestitionen selbst zu produzieren. Es spricht nicht gegen diese Modelle, dass einige der Angebote am Markt überteuert sind. Es wäre sogar überraschend, wenn dem nicht so wäre.
Wo immer eine Bezahlung in kleinen monatlichen Raten möglich ist, hoffen einige Anbieter, dass Kunden weniger genau hinschauen. Wer auf diesen Trick nicht hereinfällt und Angebote sorgfältig vergleicht, für den kommen Pachtmodelle als Alternative zum Kauf einer Photovoltaikanlage ernsthaft in Betracht.
Letzte Aktualisierung: 15.03.2023